Ganz nah an der Technik
Vor hundert Jahren nahm das Kaiser-Wilhelm-Institut für Strömungsforschung seine Arbeit auf. Aus ihm wurde das heutige Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, das grundlegende Fragen der Physik vernetzter dynamischer Systeme erforscht und damit seiner Leidenschaft für die großen physikalischen Zusammenhäng treu geblieben ist
Vor hundert Jahren nahm das Kaiser-Wilhelm-Institut für Strömungsforschung seine Arbeit auf. Aus ihm wurde das heutige Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, das grundlegende Fragen der Physik vernetzter dynamischer Systeme erforscht und damit seiner Leidenschaft für die großen physikalischen Zusammenhäng treu geblieben ist. Seit zwanzig Jahren stehen auch wieder Probleme der Strömungsphysik auf der Agenda – mit Nutzen auch für neue Technologien. Der Blick in die Anfänge des Instituts zeigt, wie die Grundlagenforschung Pioniertechnologien beflügelte, allen voran die Luftfahrt. Die Kehrseite ist ein besonders hohes Dual-Use-Risiko dieser Forschung, die im Nationalsozialismus auch rasch Kriegsforschung wurde.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren aerodynamische Phänomene ein wachsendes ingenieurtechnisches Problem. Denn Türme und Brücken erreichten dank der innovativen Materialien der neuen Stahlindustrie bislang nicht vorstellbare Höhen und Spannweiten. Stürmen hielten sie allerdings nicht immer stand. Gustav Eiffels Stahlskelettturm, den Frankreich zur Pariser Weltausstellung 1889 stolz präsentierte, hatte gezeigt, was technisch möglich war. Zugleich benutzte Eiffel den mit 312 Meter damals höchsten Turm der Welt für aerodynamische Messungen. Mathematisch berechenbar und physikalisch verstanden waren das komplexe System von Luftströmung, Strömungshindernis und dessen Form jedoch nicht. Auch die Flugpioniere, die sich zur selben Zeit mit selbstgebastelten Apparaturen todesmutig in den Himmel wagten, setzten auf das Prinzip „Versuch und Irrtum“, um neue Erkenntnissen für die Verbesserung ihrer Segelmaschinen zu gewinnen.
Ludwig Prandtl war seit 1905 Professor für angewandte Mechanik an der Universität Göttingen und gründete dort 1907 die Modellversuchsanstalt für Luftfahrt, die als Aerodynamische Versuchsanstalt (AVA) 1918 zur Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft kam. Trotz der Bedeutung der AVA als international führende Forschungsstätte, sah Prandtl ein Defizit bei der Bearbeitung von Grundsatzfragen jenseits der Flugzeug-Aerodynamik. Sein Wunsch nach einer eigenen Einrichtung, die das leisten sollte, erfüllte sich 1925 mit der Gründung des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Strömungsforschung.
Ein Doppelinstitut für Theorie und Praxis
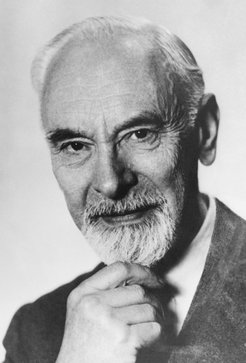
Neu und ungewöhnlich für die Zeitgenossen war, dass Prandtl die Lösungen für Probleme, die beispielsweise Flugzeugkonstrukteure und Architekten mit Luftströmungen hatten, mathematisch anging. So war es Hugo Junkers 1915 zwar gelungen in seiner Fabrik für Badeöfen das erste funktionsfähige Ganzmetallflugzeug zu bauen. Doch die Frage, welche Kräfte es in der Luft hielten, war zu dem Zeitpunkt noch vollkommen ungeklärt. Eine systematische Lösung erlaubte erst die von Prandtl entwickelte Tragflügeltheorie, die das Zusammenspiel von Über- und Unterdruck an einem angestellten Flügel unter Berücksichtigung der Strömungsgeschwindigkeit physikalisch beschrieb und berechenbar machte. Dass seine Theorie, die er bereits im Ersten Weltkrieg entwickelt hatte, erst 1918 den Flugzeugkonstrukteuren bekannt wurde, zeigt, welche gewaltige Kluft zwischen Wissenschaft und Ingenieurtechnik, zwischen Erkenntnis und Anwendung in der Aerodynamik klaffte.
Beide Zugänge – der praktisch-experimentelle sowie der mathematisch-physikalische – sollten sich nun in dem „Kaiser-Wilhelm-Institut für Strömungsforschung verbunden mit der Aerodynamischen Versuchsanstalt“ ergänzen. Die innovative Methodik, die Prandtl als neues Paradigma in der Wissenschaft etablierte, bestand darin, theoretische Probleme der Strömungsmechanik mithilfe von Modellen in hochspezialisierten Versuchsanlagen zu lösen. Ein Ansatz, den heute jeder Automobil- sowie Flugzeughersteller oder auch Brückenbauer verfolgt. Der Forschungsansatz des neuen Doppelinstituts ging allerdings – wie sein Name verrät – weit über die Aerodynamik hinaus. Im Fokus standen vielmehr jegliche Art von Strömungen in Gasen und Flüssigkeiten sowie die Turbulenz.
Die Neugründung machte Göttingen nicht nur zu einem Mekka der jungen Aerodynamik, sondern war auch ein Schritt hin zum arbeitsteiligen und hochspezialisierten modernen deutschen Wissenschaftssystem. In ihm fanden Staat, Industrie und Forschung erstmals zu einem ebenso spannungsreichen wie beflügelnden Interessensnetzwerk zusammen. Wissenschaftliche Erkenntnisse erlangten eine nie dagewesene Bedeutung als Teil einer Wertschöpfungskette der Produktion von Wissen und dessen Anwendung.
Forschung als Großbetrieb
Dass Erkenntnisse aus klassischen akademischen Disziplinen auch der technologischen Anwendung zugutekamen, war ein Konzept, das im deutschen Wissenschaftssystem zum Ende des 19. Jahrhundert alles andere als selbstverständlich war. Wissenschaft diente gemäß dem Humboldt‘schen Bildungsideal der humanitären Selbstverbesserung des Individuums und war in erster Linie zweckfrei.
Doch der Gedanke, dass sie auch der aufstrebenden Großindustrie und dem Staat nützlich sein könnte, setzte sich immer weiter durch. 1910 goss Adolf von Harnack, Theologieprofessor und wissenschaftspolitischer Berater des Kaisers, ihn in ein Konzept, das zur Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft führte. Harnack entwarf auch die Vision des modernen Wissenschaftssystems als „Großbetrieb“. Dieser setzte einerseits auf Arbeitsteilung, andererseits auf Teamwork und starke Vernetzung der separierten Elemente und verankerte die Forschung zusammen mit Staat und Ökonomie im selben Interessensfeld. Staatlicherseits fand dieses Konzept großen Zuspruch.
Im Dienst des Dritten Reichs
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten begann für das Institut eine Phase der Expansion. Zu den militärischen Projekten der Regierung Hitler, die seit 1935 massiv aufrüstete, gehörte auch die Luftfahrt. Das Reichsluftfahrtministerium bewilligte 1933 umgehend verschiedene Bauprojekte des Instituts, das in den folgenden Jahre personell stark wuchs – das betraf vor allem den Teil der AVA, die mit über 700 Mitarbeitenden im Zweiten Weltkrieg zu einer Großforschungseinrichtung wurde.

Prandtl trat zwar nie in die NSDAP ein, aber er richtete die Grundlagenforschung seines Institut immer stärker auf militärische Belange der Regierung aus. Die AVA und auch das KWI übernahmen Aufträge für das Militär ohne ihr Forschungskonzept grundlegend ändern zu müssen, denn das Interesse der Forscher an Grenzschichten und Turbulenz waren kompatibel mit den militärischen Interessen des NS-Staats an innovativen Schiffen und Flugzeugen für den deutschen Angriffskrieg. Um zielsicherere Torpedos, strahlgetriebene Raketen, schnellere U-Boote und wendigere Flugzeuge zu konstruieren, brauchte die Rüstungsindustrie auch Methoden aus der Strömungsphysik. Die AVA und das Institut wiederum konnten anhand der praktischen ingenieurtechnischen Probleme nicht gelöste Forschungsfragen bearbeiten und waren zudem umfassend finanziert.
1935 richtete das KWI einen speziellen Strömungskanal für die Untersuchung der Rauigkeit von Schiffsplatten ein und arbeitete dabei eng mit der Marinewerft in Wilhelmshaven zusammen. Da das Projekt keine raschen Ergebnisse lieferte, stellte die Marine es allerdings 1941 ein. Die Rauigkeit von Oberflächen ist für Strömungen hochrelevant, weil sie einen entscheidenden Einfluss auf den Widerstand, die Strömungsstruktur und den Energieverlust eines strömenden Mediums (wie Luft oder Wasser) hat. Je rauer beispielsweise die Oberfläche einer Rohrleitung oder Pipeline ist, desto mehr Reibung entsteht, weil die kleinen Unebenheiten Wirbel erzeugen und Energie aus der Rohrströmung ziehen. Noch heute sind die wissenschaftlichen Ergebnisse dieser Untersuchung richtungsweisend.
Abwendung der Schließung

Ingenieurstüfteleien wie dem
Schlörwagen (oben im Bild), Aufsehen erregte, erforschten die Physiker des Kaiser-Wilhelm-Instituts die Grundlagen der Strömung.
Der Zusammenbruch Deutschlands am Ende des Zweiten Weltkriegs führte zunächst zum Aus der AVA, da die Alliierten jegliche Art von Luftfahrtforschung als Rüstungsforschung verboten. Das KWI-S hingegen wurde mit der Gründung der Max-Planck-Gesellschaft 1948 in diese übernommen und die Forschung fast bruchlos weitergeführt. Nach der Emeritierung von Prandtl wurde Albert Betz, der vormals die AVA geleitet hatte, Direktor. Und der Prandtl-Schüler Walter Tollmien wurde an das Institut berufen (er übernahm 1957 die Leitung). Er trug entscheidend dazu bei, dass die Strömungsphysik zu einer interdisziplinären Wissenschaft von enormer Bedeutung wurde. Die moderne Turbulenzforschung, die den Prototyp für die Chaostheorie darstellt, ist eng mit seinem Namen verbunden. Bei ihm promovierte 1957 auch der spätere Gründungsdirektor des Max-Planck-Instiuts für Meteorologie und Nobelpreisträger für Physik (2021), Klaus Hasselmann.
In den 1975er-Jahren erweiterte das Institut seine Forschung basierend auf einem vom Göttinger Nobelpreisträger Manfred Eigen vorgeschlagenen Plan. Mit den Direktoren Jan-Peter Toennies, Hans Pauly und Heinz-Georg Wagner wurde der Schwerpunkt auf die Untersuchung molekularer Wechselwirkungen, Atom- und Molekülphysik sowie Reaktionskinetik gelenkt. Ernst-August Müller setzte unterdessen die Grundlagenforschung im Bereich der Strömungsdynamik fort und konzentrierte sich dabei insbesondere auf die Aeroakustik.
Rückkehr der Strömungsforschung
Theo Geisel verlagerte den Schwerpunkt 1996 auf nichtlineare Dynamik und deren Anwendungen in den Neurowissenschaften und der Netzwerkdynamik. Mit Stephan Herminghaus und Eberhard Bodenschatz wurde dann 2003 die Forschung an Fluiden wieder am Max-Planck-Institut etabliert. Der Forschungsschwerpunkt verlagerte sich auf die Untersuchung von Dynamik und Selbstorganisation in einer Vielzahl von Bereichen – von der Zellbiologie über Granulate und Turbulenz bis hin zur Wolkenphysik und sogar zum öffentlichen Nahverkehr. 2004 wurde das Institut daher in Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation umbenannt.

Mit dem neuen Windkanal steht dem Institut seit 2010 auch wieder ein weltweit einzigartiges Großgerät zur Verfügung. Unter anderen untersucht dort die Forschungsgruppe von Claudia Brunner, wie sich Windkraftanlagen in turbulenten Strömungen verhalten. Die Gruppe will Aufschluss über Wechselwirkungen von Luftströmungen gewinnen und damit langfristig die Effizienz von Windparks verbessern. Die Idee, dass die Strömungsforschung bei der Gewinnung von Energie aus Wind entscheidend helfen könnte, ist allerdings so alt wie das Institut. Schon 1920 hatte Betz in seiner Doktorarbeit bei Prandtl die maximale Leistung von Windkraftanlagen berechnet. Dieses Betz‘sche Gesetz findet noch heute Anwendung.
1926 legte Ludwig Prandtl das Konzept für eine „Forschungs- und Prüfungsanstalt für Windkraftnutzung“ vor, da es an Grundlagenwissen für Technologien fehle, die die „Energie der bewegten Luft“ nutzbar machen könnten. Weitsichtig warnte Prandtl, dass „die beiden wichtigsten Energiequellen, welche das heutige Industriezeitalter in seinen Dienst gestellt hat, Kohle und Oel, keineswegs unerschöpflich sind.“ Es sei damit zu rechnen, „dass der Vorrat eines Tages zu Ende gehen wird, zumal wenn der Verbrauch weiter, wie in den letzten Jahrzenten, in steiler Kurve ansteigt.“ Den Klimawandel als Treiber für den Ausbau erneuerbarer Energien hatte er dabei noch nicht im Blick.
Prandtls Vorschlag blieb auf dem Papier. Erst in den 1980er-Jahren wurden Technologien zur Erschließung der Windenergie markteffizient. Prandtls aus heutiger Perspektive so visionär anmutende Denkschrift erinnert daran, dass Technologiewege Ergebnisse politischer Entscheidungen sind. Die Grundlagenforschung kann dafür die Richtung weisen, indem sie das Machbare auslotet und zukunftsfähige Visionen entwickelt.




